Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Lochkreis der Felgen: die wichtigste Kennzahl beim Felgenkauf
Was ist der Lochkreis bei Felgen?
Im Fachjargon der Autohersteller werden Anzahl und Abstand der Löcher in einer Felge als „Lochkreis“ bezeichnet und mit LK abgekürzt. Position und Zahl der Radschrauben an der Radnabe definieren den Lochkreis der Felgen. Folgende Grössen können dabei variieren:
- Anzahl der Radschrauben-Löcher
- Durchmesser der Radschrauben-Löcher
- Durchmesser des Lochkreises der Felgen
- Grösse der Radnabenbohrung
Wenn diese Werte an Radnaben und Rädern nicht exakt zusammenpassen, gestaltet sich die Montage der Räder schwierig – in manchen Fällen ist sie sogar unmöglich. Deshalb solltest du dir vor dem Kauf neuer Felgen die Felgenbezeichnung genau ansehen.
Was genau ist eine Radnabe?
Die Radnabe verbindet die Räder deines Autos mit der Achse und teilweise auch mit der Antriebswelle. Auf der Radnabe befinden sich ebenso Bohrlöcher wie im Lochkreis der Felgen. Die Löcher an der Radnabe haben ein Innengewinde. In dieses Gewinde werden die Radschrauben eingeschraubt. Die Radschrauben – auch „Radbolzen“ genannt – haben ein Aussengewinde, das genau zum Innengewinde der Radnabe passen muss.
Wo steht in der Felgenbezeichnung die Anzahl der Löcher?
Die Felgenbezeichnung findest du zumeist auf der Rückseite der Felge eingeprägt. Sie besteht aus einer alphanumerischen Kombination verschiedener Kennzahlen und sieht beispielsweise so aus:
- 7Jx 16 H2 ET28 LK 5x100
Die Buchstabenkombination LK am Ende der Felgenbezeichnung steht für den Lochkreis der Felgen. Mit der ersten Zahl – der Fünf – wird die Lochanzahl bezeichnet. Die zweite Zahl steht für den diagonalen Abstand des Mittelpunkts eines Bohrlochs zum gegenüberliegenden Punkt am Lochkreis der Felgen. Ein Lochkreis mit der Bezeichnung LK 5x100 oder 5/100 besteht also aus fünf Felgenlöchern im Abstand von hundert Millimetern.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
Rümlang
Marina & Miraglia Autospritzwerk GmbH
PremiumRiedackerstrasse 7b, 8153 Rümlang0 Bewetungen0448... Nummer anzeigen 044 818 04 08 -
 Affoltern am Albis
Affoltern am AlbisALBIS-GARAGE SCHAUB AG
PremiumIndustriestrasse 20, 8910 Affoltern am AlbisALBIS-GARAGE SCHAUB AG wurde mit 4.59 von 5 Sternen bewertet4.595 Bewetungen0447... Nummer anzeigen 044 761 48 48 -
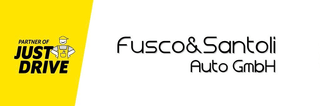 Regensdorf
RegensdorfFusco & Santoli Auto GmbH
PremiumTrockenloostrasse 55, 8105 RegensdorfFusco & Santoli Auto GmbH wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.93 Bewetungen0448... Nummer anzeigen 044 840 37 66 *
Felgenbreite, Durchmesser und mehr – Was bedeuten die anderen Angaben auf der Felgenbezeichnung?
Neben dem Lochkreis der Felgen und der Lochanzahl für die Radbolzen werden in der alphanumerischen Felgenbezeichnung noch weitere spezifische Werte angegeben. Hier haben wir den Rest der weiter oben verwendete Kombination 7Jx 16 H2 ET28 LK 5x100 komplett für dich entschlüsselt:
- 7 steht für die Felgenbreite in Zoll
- J ist der Schlüssel für die Form des Felgenhorns
- x bedeutet Tiefbettfelge
- 16 bezeichnet den Flegendurchmesser in Zoll
- H2 ist der Schlüssel für zwei Humps
- ET28 steht für die Einpresstiefe des Reifens in Millimetern
Zusammen mit der Anzahl der Löcher und dem Lochkreis der Felgen reichen diese Angaben aus, um ein Rad zu finden, das exakt auf deine Radnabe passt.
Wie finde ich heraus, welche Reifen und Felgen auf meinen Anhänger passen?
Bei Felgen für einen Anhänger gelten dieselben Regeln wie bei Autofelgen. Was die Reifen eines Anhängers betrifft, müssen diese in der Schweiz mindestens für eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern ausgelegt sein. Wenn die Höchstgeschwindigkeit des Zugfahrzeugs beschränkt ist, sind auch Reifen zugelassen, die auf die Höchstgeschwindigkeit des Zugfahrzeugs ausgelegt sind. Das gilt für Winter- wie auch für Sommerreifen. Angaben über die mögliche Höchstgeschwindigkeit deines Autos findest du im Betriebshandbuch oder im Internet. An der Seitenwand jedes Reifens befindet sich der sogenannte „Geschwindigkeitsindex“. Durch ihn erkennst du, ob sich ein Reifen für deinen Anhänger eignet. Er ist der letzte Buchstabe in einer alphanumerischen Kombination wie beispielsweise 205/55 R16 91 V. Die verschiedenen Buchstaben haben folgende Bedeutungen:
- Q = 160 Stundenkilometer
- R = 170 Stundenkilometer
- S = 180 Stundenkilometer
- T = 190 Stundenkilometer
- U = 200 Stundenkilometer
- V = 240 Stundenkilometer
- W = 270 Stundenkilometer
- Y = 300 Stundenkilometer
Kann ich den Lochkreis der Felgen selbst ausmessen?
Theoretisch kannst du die diagonalen Abstände der Felgenlöcher selbst ausmessen. Bei einer geraden Anzahl von Bohrungen ist das relativ einfach. Ermittle dazu genau die Lochmitte an zwei diagonal gegenüberliegenden Löchern. Das Mass dazwischen ist der Abstand – die Zahl nach dem x in unserem Beispiel LK 5x100. Bei einer ungeraden Anzahl von Bohrlöchern misst du von der Lochmitte bis zur Radmitte und verdoppelst den ermittelten Wert.
Wo erfahre ich, welche Felgentypen ich an mein Auto montieren darf?
Im Schweizer Typenschein – auch Typengenehmigung – und auf der EG-Übereinstimmungsbescheinigung COC findest du die Angaben zu Dimensionen, Material und Marken von Felgen, die für dein Fahrzeug genehmigt wurden. Andere Varianten wie Zwischengrössen gelten als „Fremdfelgen“ und dürfen nicht an dein Auto montiert werden.
Der Garagevergleich für die Schweiz. Finde die besten Garagisten in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Garagisten
Das könnte dich auch interessieren
Autos mit Schiebetüren: Informationen und Tipps zu den idealen Familienfahrzeugen
Wer mit Kindern unterwegs ist, kennt das Problem: Die Kleinen öffnen einfach die Autotür und touchieren das daneben parkende Auto. Die unschöne Schramme oder Delle kann für die Eltern teuer werden. Bei Autos mit Schiebetüren besteht dieses Risiko nicht, da diese Türen keinen Platz benötigen. Nicht nur bei Familienautos wie Minivans sind Schiebetüren sehr praktisch, sondern auch bei Transportern. Welche Vor- oder Nachteile Autos mit Schiebetüren haben und welche Modelle es gibt, erklären wir dir in unserem Ratgeber. Ausserdem erfährst du etwas über die unterschiedlichen Varianten.
Ohne Zahnriemenwechsel droht ein Motorschaden
Viele Autofahrer neigen dazu, den anstehenden Zahnriemenwechsel aufzuschieben. Das ist nur allzu verständlich, denn schnell sind ein paar Hundert Franken weg und jeder fragt sich, ob das denn wirklich sein muss. So fahren einige dann mit schlechtem Gewissen und dem überalterten Zahnriemen, während sie hoffen, dass er nicht reissen wird. Doch er reisst irgendwann. Wenn das passiert, wird es teurer als eine Vielzahl von Zahnriemenwechseln. Die Folge ist nämlich ein kapitaler Motorschaden. Ein Zahnriemen, dessen Wechselintervall überschritten ist, ist keine Bagatelle wie ein abgefahrener Reifen oder ein paar Kratzer an den Felgen, sondern ein ernstes Problem.
Reifenprofil messen: Welche Profiltiefe ist vorgeschrieben und gibt es Unterschiede zwischen Winter- und Sommerreifen?
In der Schweiz wird für Motorradreifen im Sommer eine Profiltiefe von wenigstens 1,0 Millimeter gefordert. Bei Autoreifen sind es im Sommer 1,6 Millimeter, bei Winterreifen dagegen 4,0 Millimeter. Diese Vorgabe betrifft auch die Profilrillen von Ganzjahresreifen: Winterreifen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Vorgeschrieben ist lediglich eine Bereifung, die dir die Beherrschung deines Fahrzeugs in der jeweiligen Situation erlaubt. Wenn du mit Ganzjahresreifen auf Schnee ausreichend Grip auf der Fahrbahn hast, ist das in Ordnung. Aber wie sieht so eine Messung der Profiltiefe aus? Idealerweise untersuchst du die Lauffläche deiner Winter- und Sommerreifen jeweils beim Reifenwechsel.
Scheinwerfer polieren – so geht es richtig
Auch bei guter Pflege sieht man den Autoscheinwerfern irgendwann ihr Alter an. Durch Schmutz und die UV-Strahlung der Sonne werden sie mit der Zeit blind. Zudem kommen immer mehr kleine Kratzer hinzu, die das Scheinwerferlicht streuen und andere Verkehrsteilnehmer blenden können. Nun musst du aber zum Glück nicht gleich neue Scheinwerfer kaufen. Sofern keine Risse oder andere Beschädigungen vorhanden sind, können Scheinwerfer mit ein wenig Zeit und Mühe wiederaufbereitet werden. Wir zeigen dir, wie du beim Scheinwerfer Polieren vorgehest, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Motorrad Rangierhilfe – Rangierschiene, Hauptständer und anderes Zubehör
Grosses Motorrad, kleine Garage – wie bekommst du das zusammen? Ganz einfach: Mit einer Rangierschiene. Die Motorrad Rangierhilfe ist immer dann nützlich, wenn deine Motorräder in einem engen Raum abgestellt oder bewegt werden müssen. Ob du einen Rollwagen, eine Rangierplatte oder einen Motorradheber verwendest, ist dabei eigentlich egal: Die Produkte sind alle recht nützlich, wenn du dein Motorrad drehen oder quer stellen willst. aber wie sieht so eine Motorrad Rangierhilfe genau aus? Wo bekommt man so ein Teil? Du hast die Fragen, wir die Antworten.
Auffahrrampe Auto – wichtige Auswahlkriterien und Informationen für die sichere Verwendung
Wenn du deinen Pkw transportieren oder ihn für eine Reparatur aufbocken möchtest, ist dir eine solide Auffahrrampe für Autos dabei behilflich. Mit der Verladerampe lässt sich der Höhenunterschied von der Strasse auf den Anhänger problemlos überbrücken. Bei einer Kfz-Reparatur kann ein Wagenheber ausreichen, um den Wagen hochzubocken, doch für den Transport eines Autos ist die Rampe unverzichtbar. Wichtig ist, dass die Auffahrrampe die richtige Stabilität und Grösse für dein Fahrzeug hat.

